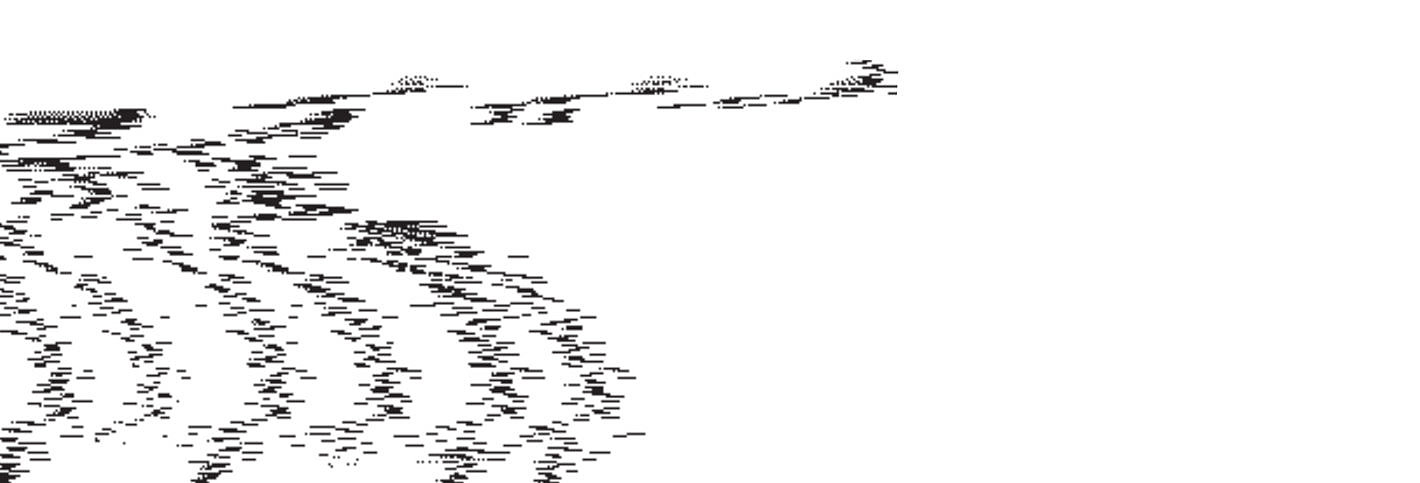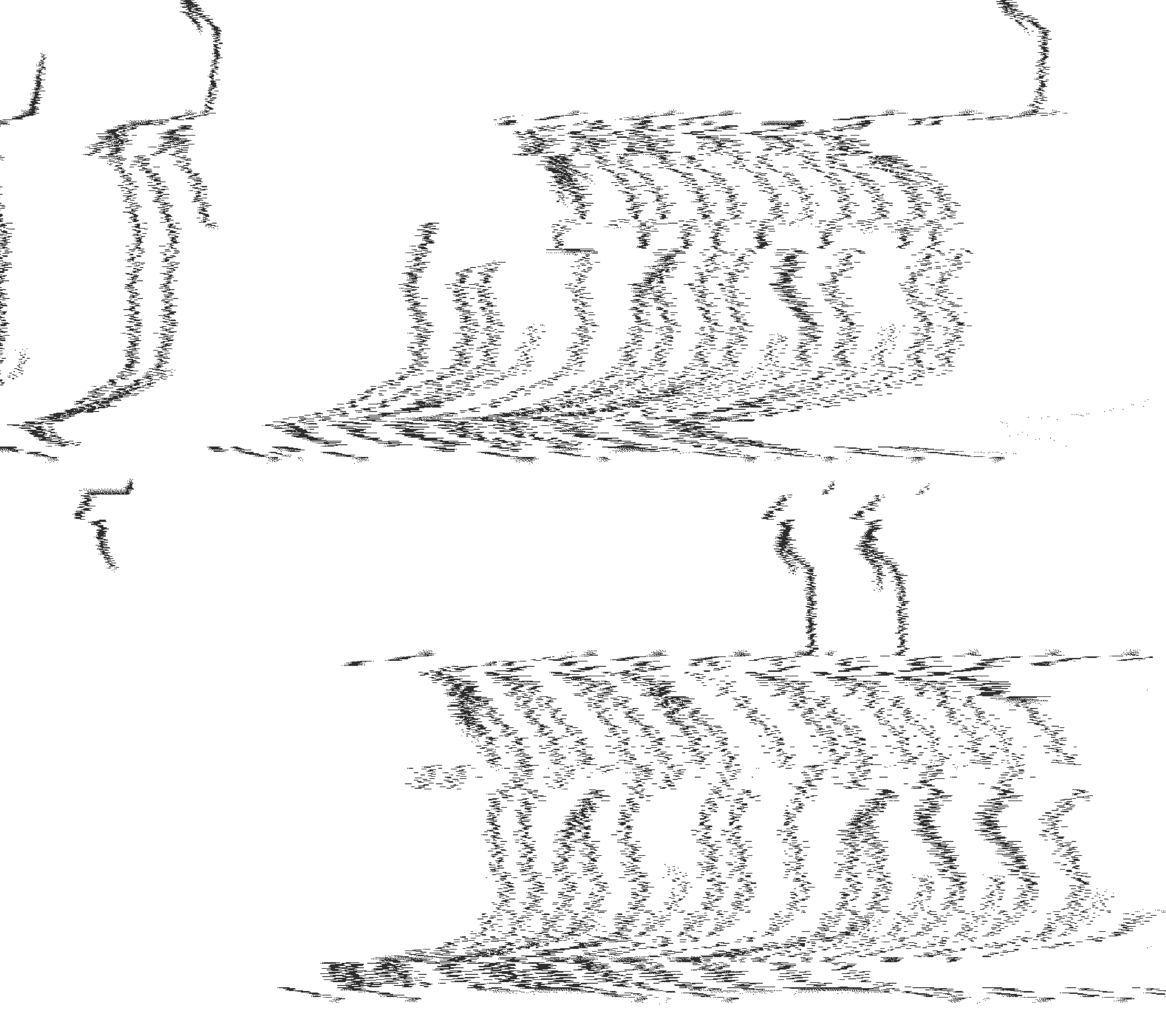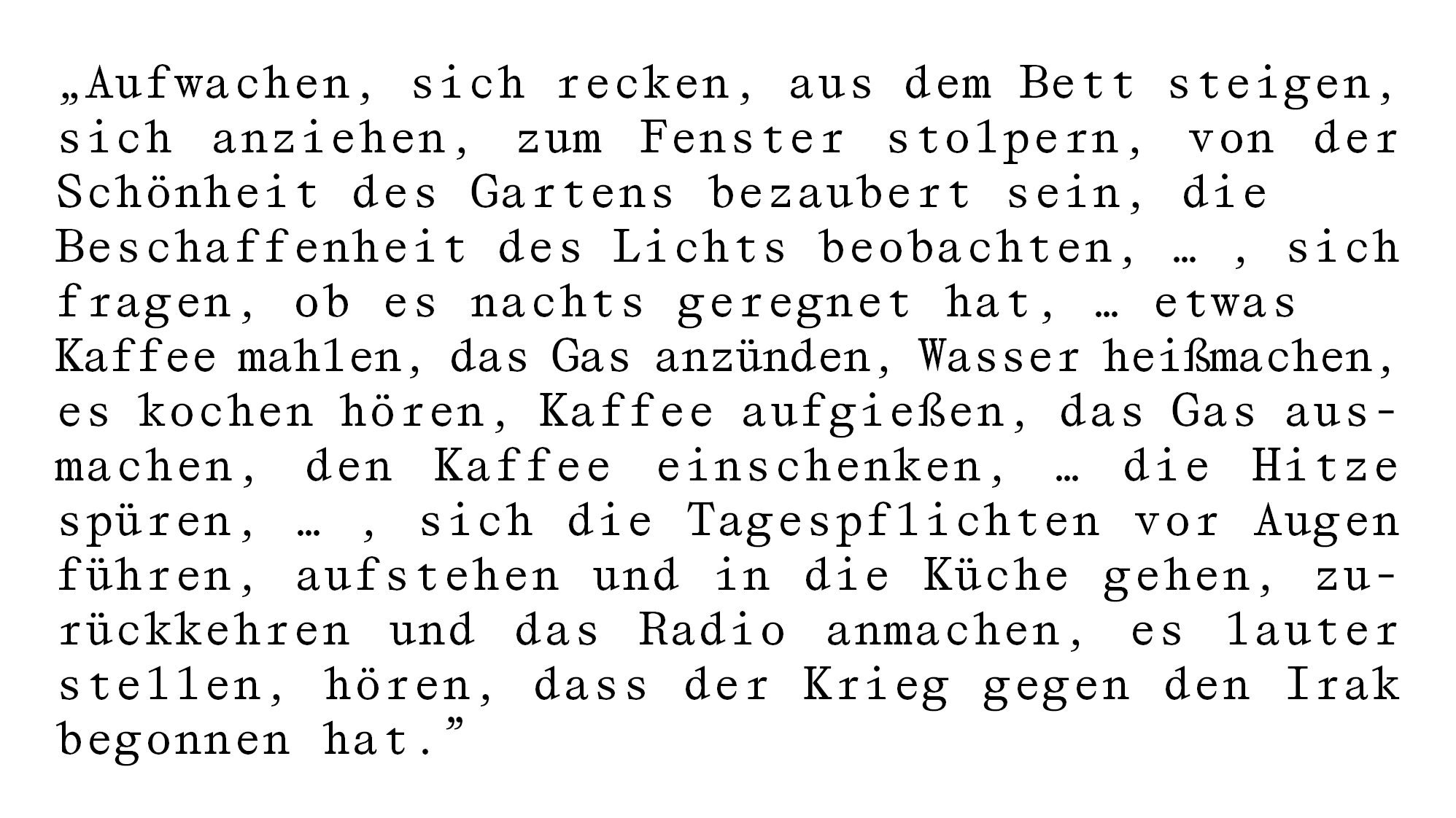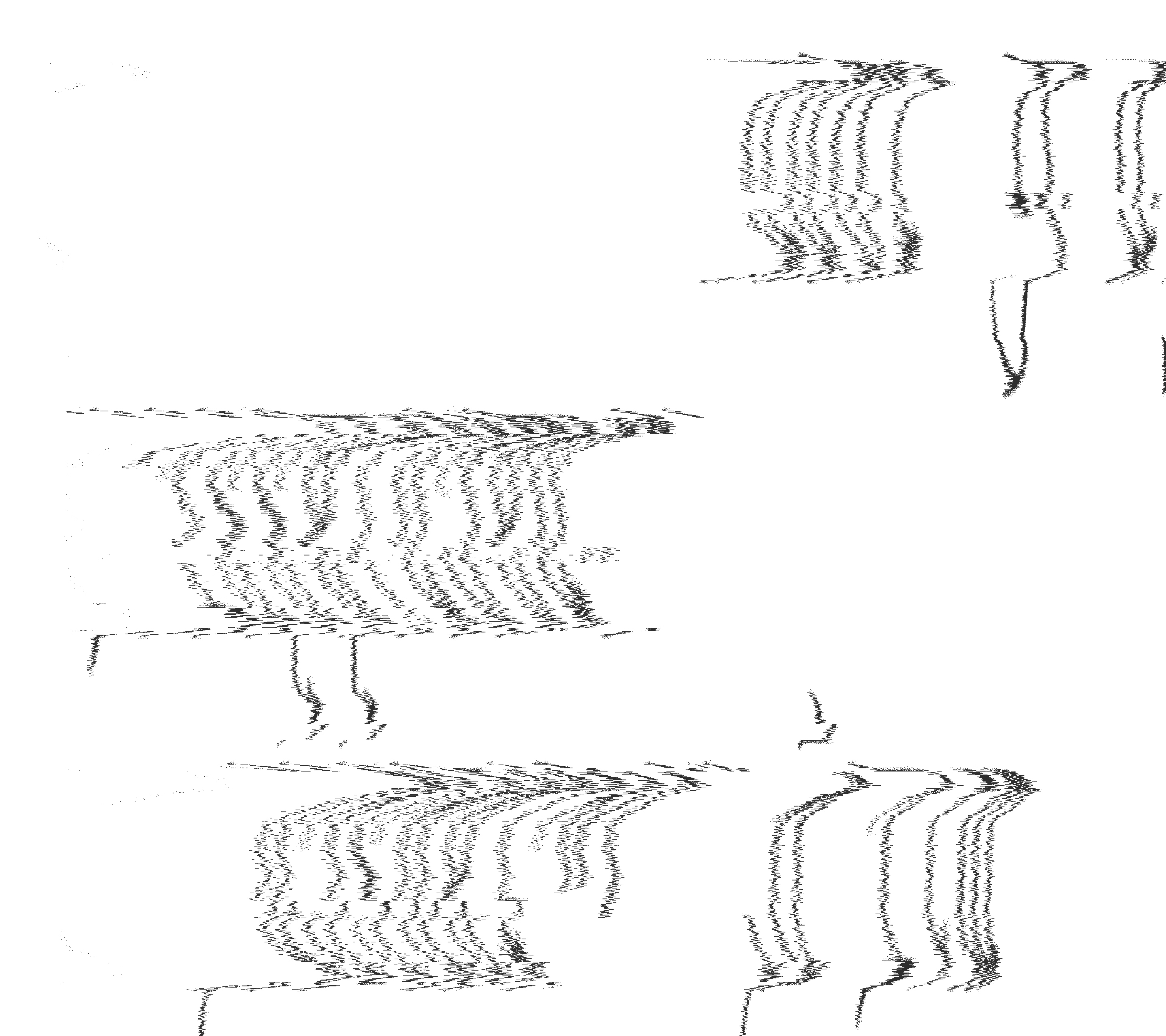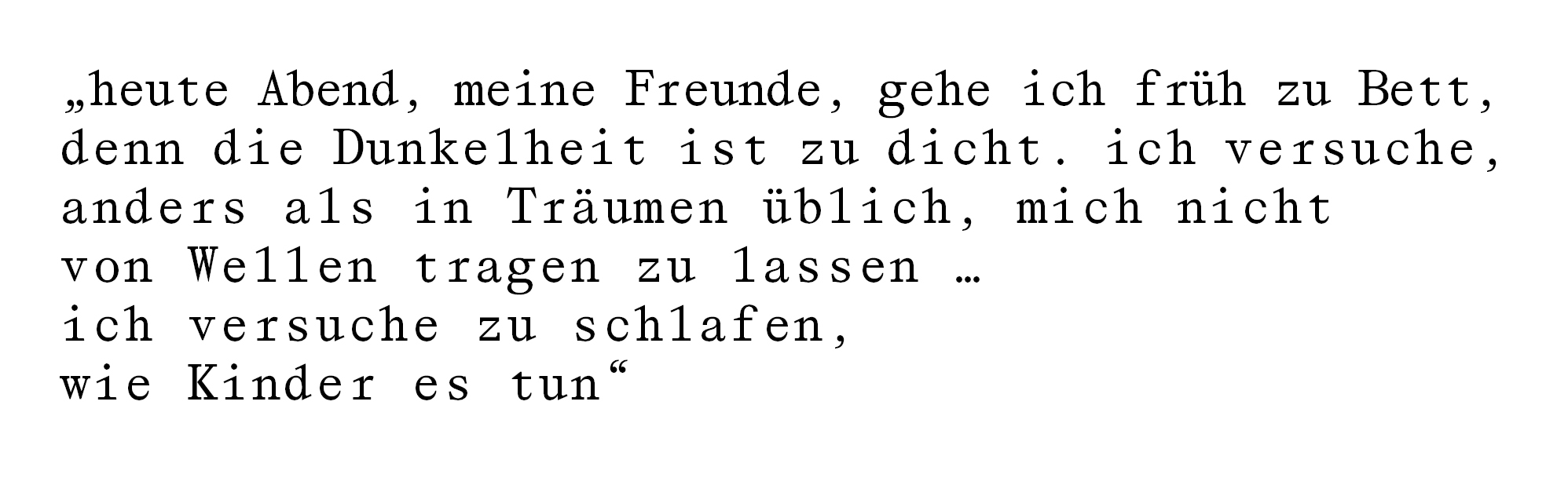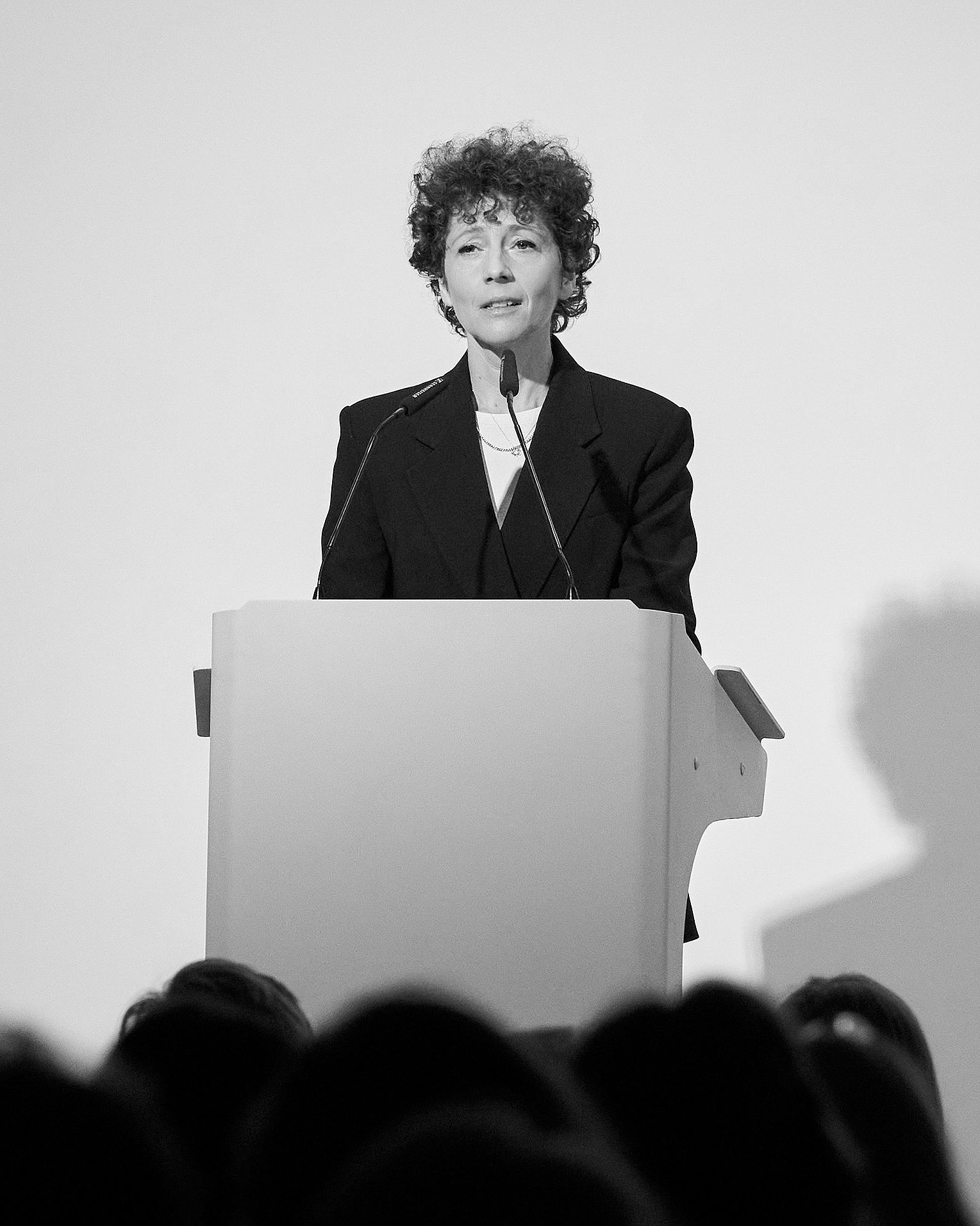Vor einigen Wochen flog ich nach einer Lesereise von Boston zurück nach Deutschland, nach München. Am Gate fiel mir diese Frau auf, sie sah sich unschlüssig um, blickte suchend nach links und rechts. Ein Mann redete in lautem Englisch auf sie ein, sie verdrehte den Kopf, in ihrer Hand der dunkelblaue Pass mit dem gelben Dreizack, dem Staatswappen der Ukraine. Sie war so schmal und reichte dem Mann, der auf sie einsprach, kaum bis zur Schulter. Ganz offensichtlich versuchte er ihr weiterzuhelfen, aber sie hob nur immer wieder fragend die Arme. Ich zögerte, dann gab ich mir einen Ruck, ich hatte keine andere Wahl und keine andere Sprache: Wenn ich sie fragen wollte, ob sie Unterstützung brauchte, musste ich es auf Russisch tun.
Sie habe die Durchsagen nicht verstanden, sie könne kein Englisch und kaum Deutsch. Ich übersetzte für sie, und wir kamen ins Gespräch. Sie erzählte, dass sie in Boston ihren Sohn besucht habe, nun fliege sie nach München, dort wohne ihre Tochter schon seit vielen Jahren, sie selbst erst seit der Kriegsausweitung 2022. Sie wollte wissen, was ich beruflich mache, und strahlte mich an, als ich sagte, ich sei Schriftsteller*in. Was ich denn schreibe, fragte sie, und ich antwortete, dass mein letzter Roman „Im Menschen muss alles herrlich sein“ heiße. Ah, sagte sie, Tschechow, ein Zitat aus Onkel Wanja, und wie schön das sein müsse: Literatur, Lesereisen, Berlin. Wo ich geboren sei?
In Russland. In Wolgograd, aufgewachsen in Moskau.
Der Blick, das Zucken in ihrem Gesicht. Sie mühte sich ein Lächeln ab und erzählte, dass ihre Verwandten und Freundinnen alle in Kyiv seien, eigentlich alle außer ihre Kinder. Dass sie das Land auf keinen Fall verlassen wollten, und dass sie immer noch bei jeder Gelegenheit ins Theater gingen. Nur: Tschechow würde nicht mehr gespielt. Und dann schaute sie mich an und sagte ohne jeden Vorwurf und auch nicht als Mahnung, sondern als bloße Feststellung: „Wir werden für immer Feinde sein. Sie und ich. Das ist ab jetzt unser Erbe, Ihres und meines.“
Wir gingen nebeneinander die Flugzeugbrücke entlang, blieben höflich. In der Maschine saßen wir in unterschiedlichen Reihen. Ich über einem der Flügel. Und als die Triebwerke aufheulten, spürte ich sie bis in meinen Bauch, als zerkleinerten sie meine Eingeweide.